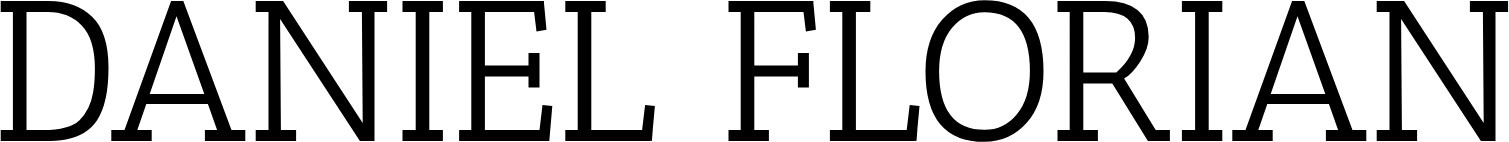Der Bürger ist ein widersprüchliches Wesen. So spricht sich in Umfragen regelmäßig eine breite Mehrheit für die Energiewende aus, sobald jedoch eine neue Stromtrasse oder Windräder in der eigenen Nachbarschaft gebaut werden sollen, schlägt die Stimmung um. Die Menschen wollen gesellschaftlichen Wandel, aber sie wollen nicht ihr Verhalten ändern.
In der Politikberatung wird diese Tatsache weitgehend ignoriert. Wirtschaftswissenschaftler sprechen heute immer noch vom homo oeconomicus, dem rationalen Menschen – und ignorieren, dass wir oft eher wie Homer Simpson dem kurzfristigen Genuss hinterherjagen, statt unser langfristiges Wohl im Blick zu haben. Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen, hat das Kanzleramt vor gut einem Jahr drei Stellen für Verhaltensökonomen ausgeschrieben. Nach dem Vorbild der Nudge Unit der britischen Regierung, Barack Obamas Regulatory Czar oder dem MindLab der dänischen Regierung sollen die Wissenschaftler helfen, die Erkenntnisse der Verhaltensökonomie in den Gesetzgebungsprozess einfließen zu lassen.
Wird der Bürger zur “Labormaus” degradiert?
Die Idee des nudging, eines sanften “Schubses” der Bürger in die richtige Richtung, wurde 2008 mit dem Buch “Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness” (Rezension) der Harvard Professoren Richard H. Thaler und Cass R. Sunstein populär. Deren Grundannahme lautet, dass viele Menschen aufgrund kurzfristigen Denkens, fehlender Informationen oder schlicht Trägheit ignorieren, was langfristig in ihrem Interesse ist. Mit nudges hilft der Staat den Bürgern, bessere Entscheidungen zu treffen.
Ein Beispiel: Mehr als die Hälfte der Deutschen befürwortet Organspenden. Tatsächlich spenden jedoch nur 16 Prozent ihre Organe, weil dafür hierzulande ein Organspendeausweis notwendig ist. Deshalb fragen seit 2012 Krankenkassen ihre Versicherten alle zwei Jahre ab, ob sie sich als Organspender registrieren lassen wollen – ein kluger nudge, um die Zahl der Organspender zu erhöhen.
Und dennoch: Die Kritik an Angela Merkels Vorstoß ließ nicht lange auf sich warten. Bild warnte vor Merkels „Psycho-Trainern“, die FAZ beschwor den Nanny-Staat herauf, und Ex-Verfassungsrichter Udo di Fabio warf der Regierung sogar vor, die Bürger zu “Labormäusen” zu degradieren. Drei häufig genannte Kritikpunkte lassen sich jedoch schnell entkräften:
Erstens: “Nudging” ist Manipulation: Als Bürger, Verbraucher und Menschen stehen wir ständig vor Entscheidungen: bei der Wahl einer Steuerklasse, im Supermarkt oder wenn wir in der Kantine in der Schlange stehen. Überall gibt es nudges in Form von Standardeinstellungen, Hinweisschildern oder Sonderangeboten. Eine vollständig neutrale Umgebung für Entscheidungen existiert so gut wie nie – und in der Regel können wir damit gut umgehen. Nudging bedeutet, diese Umgebung bewusst so zu gestalten, dass sie im bestmöglichen Interesse des Nutzers ist – etwa durch ein gut sichtbares Label.
Einflussnahme ohne Verbote
Zweitens: Mit „nudging“ schaffen wir einen Nanny-Staat. Nudging bietet einen Mittelweg zwischen einer Laissez-faire-Politik, die überhaupt keine Regeln kennt, und einem klaren Verbot. Dabei gibt es zwei wesentliche Ziele: die Verbesserung des Wohlergehens der Betroffenen und die Wahrung oder Erhöhung ihrer Autonomie. Ein Nanny-Staat hingegen versucht, die Lebensziele seiner Bürger zu verändern und ihre Handlungsoptionen zu reduzieren. Es ist zum Beispiel erwiesen, dass ein übermäßiger Genuss von Softdrinks der Gesundheit schadet. Aber soll man deshalb den Verkauf von großen Cola-Bechern wie in New York City verbieten? Wäre ein Hinweis auf die möglicherweise schädlichen Folgen von exzessivem Cola-Genuss nicht angemessener? Nudging erlaubt es Politikern, positiv auf das Wohlergehen der Bürger einzuwirken, ohne durch Verbote ihre Freiheit einzuschränken.
Drittens: In einem freien Rechtsstaat sollte jeder seinen Neigungen folgen können, auch wenn sie irrational sind. Nudging verbietet niemandem, ungesundes Essen zu sich zu nehmen, sein Geld zu verjubeln oder sich auf andere Weise “irrational” zu verhalten. Allerdings gehen Nudging-Verfechter davon aus, dass die meisten Menschen nicht unter Altersarmut leiden oder Strom verschwenden wollen. Nudging baut Informationsasymmetrien ab, indem es zum Beispiel über die langfristige Folgen eines bestimmten Verhaltens aufklärt – niemand wird hingegen gezwungen, sich anders zu verhalten, als er es möchte. Es geht also nicht darum, die Präferenzen der Bürger zu ändern, sondern ihre Wahlentscheidungen so zu verbessern, dass sie auch subjektiv als vorteilhafter wahrgenommen werden.
Nicht alle Kritik an nudging ist ungerechtfertigt. Der Berliner Psychologe Gerd Gigerenzer fordert, dass der Bürger anstelle eines gutgemeinten Stupses von außen lieber selbst in die Lage versetzt werden sollte, richtige Entscheidungen fällen zu können – etwa durch bessere Bildung. Die Forderung stößt allerdings an praktische Grenzen, da wir täglich hunderte Entscheidungen in Dutzenden von Fachgebieten treffen – von Gesundheit und Ernährung über Finanzthemen bis hin zu umweltbezogenen Entscheidungen beim Kauf eines neuen Autos. Es scheint wenig realistisch, sich in all diesen Gebieten ausreichend Fachwissen anzueignen.
Die Vorzüge der Verhaltensökonomie
Die Kritik besonders liberaler Ökonomen wie etwa Karen Horn, die nudging in einem Artikel für die FAZ als “Anschlag auf die Freiheit” bezeichnete und Befürworter als “Sklavenhalter der Zukunft” beschimpfte, ist daher nicht nur unangemessen, sondern auch unverständlich. Das Gegenteil trifft zu: Im Vergleich zu einem echten Verbot ermöglicht nudging sogar mehr Freiheit für Bürger und Verbraucher, nicht weniger.
Im Rahmen eines Vortrages über die Ethik des nudging hat Cass Sunstein zu Recht darauf hingewiesen, dass die abstrakte Kritik an nudging von den eigentlichen Herausforderungen ablenkt. Natürlich bieten nudges die Gefahr von Manipulation, aber anstatt verhaltensökonomische Regulierungsansätze deswegen grundsätzlich abzulehnen, sollten Kritiker lieber für bessere nudgeswerben. Schließlich ist die Verhaltensökonomie inzwischen ein anerkannter Teil der Wirtschaftswissenschaften und hat ihre Vorzüge gegenüber klassischen Rational-Choice-Ansätzen eindeutig bewiesen. Klar ist aber auch: Nudges spiegeln immer auch bestimmte politische Ziele wider. In einer Demokratie ist das völlig legitim. Das Kanzleramt agiert allerdings bislang bewusst zurückhaltend und betont, dass nicht die Deutschen geändert werden sollen, sondern die Gesetze, damit sie besser funktionieren.
Die aktuelle Debatte sollte sich jedoch nicht allein auf die Frage konzentrieren, ob nudging gut oder schlecht ist. Das Problem, das man mithilfe von nudges lösen möchte, ist wesentlich komplexer als die Umerziehung von vermeintlich ungehorsamen Bürgern: Es geht um die Diskrepanz zwischen verabschiedeten Gesetzen und deren Durchsetzung. Oft genug kommen etwa soziale Leistungen nicht schnell genug bei denjenigen an, die anspruchsberechtigt sind.
Beispiel Bildungspaket: Mit der öffentlichen Förderung von Musikunterricht oder der Mitgliedschaft in Sportvereinen wollte die damalige Sozialministerin Ursula von der Leyen gezielt die Teilhabe von benachteiligten Kindern an sozialen Aktivitäten fördern. Laut Evaluationsbericht haben im ersten Jahr nach der Einführung jedoch gerade einmal 34 Prozent der Anspruchsberechtigen Leistungen aus dem Bildungspaket erhalten. Als Grund wurde neben mangelnder Kenntnis über das Angebot ein kompliziertes Antragsverfahren genannt.
Hier könnten Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie helfen, die Antragstellung einfacher zu gestalten, indem man sie etwa an den Bedürfnissen der Empfänger dieser Leistungen ausrichtet und nicht an den Erfordernissen der Bürokratie. Das dänische MindLab etwa hat untersucht, warum ausgerechnet jüngere Menschen ihre Steuererklärung nicht elektronisch abgeben. Dabei kam heraus, dass die Sprache auf den Webseiten der Finanzämter für junge Steuerzahler schlichtweg unverständlich ist. Ein anderes Beispiel stammt aus Großbritannien, wo ein Team von Verhaltensökonomen die Arbeit einzelner Arbeitsämter so verbessern konnte, dass die Wahrscheinlichkeit einer Arbeitsplatzvermittlung durch diese Arbeitsämter um 17,5 Prozent höher lag als in anderen Arbeitsämtern.
Auch Schröders “Räterepublik” war erfolgreich
Thaler und Sunstein sprechen in ihrem Buch Nudging immer wieder von der Bedeutung der “Entscheidungsarchitektur”. Dieser Begriff beschreibt genauer als das Wort nudging, worum es Verhaltensökonomen geht: In einer Welt mit unzähligen Optionen ist es Aufgabe und Verpflichtung der Politik, nicht nur politische Angebote zu schaffen, sondern auch eine entsprechende Entscheidungsarchitektur mitzuliefern. Nudges in allen ihren Formen – Standardeinstellungen, Warnhinweise, Erinnerungen und Vereinfachungen – sind dabei nur ein Regulierungsinstrument des Staates neben Selbstverpflichtungen, Verboten oder Verpflichtungen. Aber sie erlauben es der Politik, Wahlfreiheit, Autonomie und die Förderung der gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrt miteinander in Einklang zu bringen.
Die Diskussion über nudges erinnert an die Feuilleton-Debatte über Gerhard Schröders “Räterepublik”. Schröder setzte lieber auf den externen Rat von parteiübergreifend anerkannten Politikern und Wissenschaftlern als auf die eigene Ministerialbürokratie, wenn es um die Entwicklung von politischen Programmen ging. Die gegnerischen Argumente waren ähnlich: Sie prangerten die Entdemokratisierung des Politikbetriebs und die Errichtung einer Technokratie an. Aber der Erfolg gibt Schröder Recht; viele der Expertenempfehlungen – von der Bundeswehrreform bis zur Einwanderungspolitik – waren ihrer Zeit voraus und werden heute erfolgreich verwirklicht.
Ähnlich sollten wir uns auch in der Diskussion über nudging nicht dazu hinreißen lassen, in jedem neuen politischen Instrument einen “Anschlag auf die Freiheit” oder die “Versklavung” der Bürger zu sehen. Gewiss, nicht alle Fragen über den besten Einsatz von nudges sind bisher ausreichend beantwortet – das Projekt “Wirksam regieren” im Bundeskanzleramt trägt auch dazu bei, unseren Erfahrungsschatz in dieser Hinsicht zu vergrößern. Dass die Erkenntnisse der Verhaltensökonomie aber wertvolle Beiträge zum Regieren im 21. Jahrhundert liefern können, ist inzwischen nicht mehr ernsthaft zu bestreiten.
Dieser Artikel ist zuerst in der Ausgabe 5/2015 der Zeitschrift Berliner Republik erschienen.
Foto: Daniel Florian