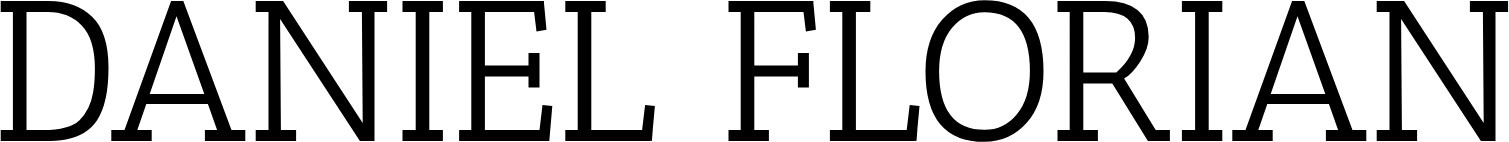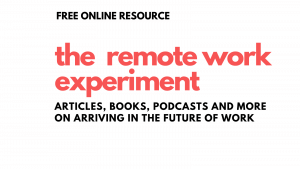Mit dem Lobbyregister ist es wie mit Steuern: eigentlich will man möglichst wenig damit zu tun haben, aber wenn man schon muss, dann soll es doch wenigstens gerecht zugehen. Und so entfaltet sich – ausgelöst durch einen Beitrag von MSL-Chef Axel Wallrabenstein im PR Report – wieder einmal die alte Debatte über das Für und Wider eines Lobbyregisters.
Florian Hohenhauer, der ebenfalls als Kommunikationsberater tätig ist, findet Wallrabensteins Argumentation für ein Lobbyregister wenig überzeugend:
MSL will kein Lobbyregister, zumindest erst einmal nicht. Eine zentrale Bedingung im Artikel lautet: “Ein Register muss alle Lobbyisten erfassen oder keinen”. Wenn das die Bedingung ist, wird es erst in ewig und drei Tagen ein Lobbyregister geben.
Natürlich: wenn man möglichst schnell ein Lobbyregister haben will, reicht ein Gesetz, das Auftragslobbyisten zur Veröffentlichung ihrer Mandate zwingt – und gut is’. Wenn man das gewünschte Ziel des Lobbyregisters ernst nimmt und nach einem Weg sucht, unbotmäßige Einflussnahme zu verhindern, wird es allerdings schon komplizierter.
Wer will, findet immer ein Schlupfloch
Das Problem liegt in erster Linie darin, zu definieren, wer überhaupt ein Lobbyist ist. Eine Untersuchung in Großbritannien fand heraus, dass 2012 nur zwei von 988 Treffen von Mitgliedern des britischen Kabinetts “Lobbytreffen” nach der Definition des britischen Lobbyregisters waren. Der Rest waren Treffen mit vermeintlich unabhängige Experten, Gewerkschaften und Arbeitgebern, NGOs oder einfach nur “alten Freunden”.
Der Graubereich ist groß genug, um immer wieder ein Schlupfloch zu finden, wenn man das will. Wer wegen Transparenzpflichten auf Public-Affairs-Berater verzichten will, gründet eben einen Think Tank. Und wenn Think Tanks auch stärker reguliert werden, greift man statt dessen auf Anwälte zurück. Deswegen fordert Wallrabenstein zurecht, dass ein Lobbyregister alle Akteure umfassen muss, die Politik und Öffentlichkeit beeinflussen wollen.
Wirkliche Transparenz kann es nur geben, wenn Abgeordnete – als das eigentliche “Ziel” der Einflussnahme – ihren Kalender so weit öffentlich machen, dass alle beruflichen Treffen dort einsehbar sind. Aber hier regt sich Widerstand im Parlament. Und natürlich muss auch die Privatsphäre eines Abgeordneten geschützt werden (auch wenn er qua Amt ein Mensch des öffentlichen Lebens ist).
Die Berater selbst sind übrigens – insofern sie Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Politikberatung sind – an bestimmte Transparenzpflichten gebunden. Bei Missachtung droht der Ausschluss aus dem Verein und ein entsprechender Reputationsverlust.
Es mangelt nicht an guten Vorsätzen, sondern an praktikablen Vorschlägen
Von größeren Skandalen ist Deutschland bisher ohnehin verschont gewesen. Organisationen wie LobbyControl und natürlich investigative Journalisten sorgen bereits heute für ein hohes Maß an Transparenz. Die Diskussion um den Wechsel von Kanzleramtsminister Eckard von Klaeden zu Daimler ist nur ein Beispiel für die ausgeprägte Debattenkultur beim Thema Interessenvertretung.
Ich kenne keinen Berater, der ernsthaft etwas gegen ein Lobbyregister hat. Aber leider gibt es nur wenige Konzepte, die sich auch in der Realität als zielführend erwiesen haben. Immer geht es dabei um die Definition, wer eigentlich ein Lobbyist ist. Und hier kommt es eben gerade darauf an, eine Regelung zu finden, die nicht nur eine schnelle Befriedigung verschafft, sondern dem eigentlichen Ziel eines Lobbyregisters – mehr Transparenz in politischen Entscheidungsprozessen zu forcieren – gerecht wird. Auch wenn das schwieriger ist.
Foto: amira_a, Lizenz: CC BY 2.0
Weitere Blogposts zum Thema Public Affairs finden Sie hier.